Als ich 5 Jahre alt war, passierte so einiges. Mein Vater spielte dabei eine traurige Hauptrolle. Er belog mich. Er brach mein Vertrauen. Als nächstes fand ich heraus, dass er Alkoholiker war. Als ich 7 Jahre alt war, bestätigte mir dann meine Mutter, dass sie mich als Grund dafür vorschob, ihn geheiratet zu haben und – schlimmer noch – auch dafür, mit ihm verheiratet zu bleiben.
Als ich 8 Jahre alt war, stand ich mit einem Messer neben meinem im Bett schlafenden Vater. Er hatte mich soweit. Ich konnte und wollte es nicht mehr ertragen. ICH KONNTE EINFACH NICHT MEHR! Dennoch ließ ich ihn überleben. Ich habe diese Entscheidung in den folgenden Jahrzehnten oft hinterfragt.
Jetzt möchte ich Dir von diesem speziellen Tag erzählen.

Es war ein ein ganz normaler Nachmittag an einem heißen Sommertag im Juli 1982. Meine Oma war draußen bei der Gartenarbeit. Meine Adoptivgeschwister waren mit ein paar ihrer Freunde unterwegs. Unsere Mutter war bei einer Kollegin eingeladen. Mein Vater schlief im Schlafzimmer zwischen seinen Dienstschichten seinen aktuellen Rausch aus oder besser gesagt, schlief er ihn runter auf seinen üblichen Alkoholiker-Betriebslevel.
Ich hatte Oma schon eine Weile geholfen. Hatte verblühte Blüten mit den Fingern abgeknipst, ausgegrabene Regenwürmer auf den Kompost umgesiedelt und Schnecken auf eine naheliegende Wildwiese. Jetzt hatte ich keine Lust mehr. Mir war einfach zu warm. Also sagte ich Oma Bescheid, dass ich reingehen und – unbelästigt von Bienen und Wespen – eine Runde lesen würde.
Ich bin ziemlich sicher, dass der Geruch der Auslöser war. Kaum betrat ich über die Terrasse die Küche, schlug mir der übliche Gestank entgegen. Das ganze Erdgeschoss war geschwängert mit dieser ganz spezifischen Duftnote aus abgestandenem Alkoholikerschweiß.
Schweiß ist nämlich nicht gleich Schweiß. Und
wenn Du jetzt denkst, Du kennst diesen Geruch, weil Du nach einer Sauftour mit
Deinem Kumpeln auch schon die eine oder andere Alkoholfahne in der Nase hattest
oder selbst vor Dir her getragen hast, dann irrst Du Dich.
Die Ausdünstungen von sporadischen Freizeitsäufern riechen anders.
Der Unterschied ist signifikant. Ich kann das deshalb beurteilen, weil meine Adoptivgeschwister das in den 70iger und 80iger Jahren übliche – und wohl leider auch heutzutage noch übliche – Teenagerverhalten an den Tag gelegt haben. Außerdem wurde sowohl von ihnen, als auch von den Erwachsenen der Nachbarschaft, dann auch noch die eine oder andere Party bei uns im Partykeller veranstaltet. Fröhliches essen – tanzen – saufen – kotzen – wieder saufen.
Mir war es immer ein Rätsel, was an all dem so toll sein sollte, dass jemand diese Erfahrung als Freizeitvergnügen ansieht. Aber das steht auf einem anderen Blatt.
Auf jeden Fall kenne ich den Unterschied zwischen den Ausdünstungen von Freizeitsäufern und von Alkoholikern. Bei Freizeitsäufern riecht der Schweiß scharf. Die überwältigend kräftige Alkoholverdunstung steht im Vordergrund. Denn der Körper mobilisiert alle Kräfte, um sich selbst schnellstmöglich von den Giftstoffen zu befreien. Die Selbstreinigung läuft auf Hochtouren. Der eigentliche Körpergeruch stellt da nur noch eine Randnotiz dar, bleibt in seiner Grundzusammensetzung dabei unverändert.
Bei Alkoholikern reagiert der Körper phlegmatischer. Es hat sich ein Gewöhnungsprozess eingestellt. Der Körper hat sich an das stets vorhandene Level des Gifts angepasst, denn er hat erkannt, dass er es nicht herausschwemmen kann. Also reagiert der Körper so effektiv, wie es ihm möglich ist, um sich selbst am Leben zu halten und spart Energie dort, wo sie sonst verschwendet werden würde. Chemische Prozesse laufen verzögert ab und/ oder nehmen einen anderen Verlauf, als bei Nicht-Alkoholikern. Ein Symptom dafür ist, dass der Körpergeruch sich ändert. Er wird schwerer und dichter und vor allem süßer. Die Person riecht ungewaschen und zwar dauerhaft. Daran ändert sich nichts, gleichgültig, wie oft sie unter die Dusche stiefelt.
Auch Alkoholiker werden darauf angesprochen, wenn sie stinken. Oder es fällt ihnen selbst auf und sie wollen sich dann einen erbärmlichen Rest ihrer Menschenwürde erhalten. So oder so, sie neigen dazu, ihren typischen Alkoholiker-Körpergeruch mit Unmengen an Deodorant zu übertünchen.
Wenn Du jetzt denkst, dass ich da nicht von meinem Vater auf Alkoholiker im Allgemeinen schließen darf, stimme ich Dir absolut zu. Ich habe dieses ganz spezielle Phänomen auch bei anderen Alkoholikern festgestellt (Bei einem meiner Arbeitskollegen. Und auch in meinem Bekanntenkreis gab es jemandes, dessen Familienmitglied entsprechend vor sich hin dünstete). Andernfalls würde ich Dich auf diese Symptomatik nicht hinweisen.
Nun, an diesem Nachmittag schlug mir also jener unverwechselbare „Duft“ wieder einmal entgegen.
Und einher ging damit folgende Erkenntnis: Es würde nicht besser werden.
Ich ging ins Halbdunkel des Schlafzimmers. Atmete flach durch den Mund, um den Gestank auszublenden, lauschte auf das leise Schnarchen meines Vaters und blickte in sein Gesicht.
Mein Vater, der mir die Liebe zur Natur beigebracht hatte, indem er mir ihre Besonderheiten in Garten, Wiesen, Feldern und Wäldern erklärte. Dieser Vater. Der neugierig war auf das Leben und einen Blick für die Schönheit eines Schmetterlings und das Ohr für den lieblichen Gesang der Feldlerche hatte. Der mir zu jeder Pflanze und jedem Tier etwas sagen konnte. Der Pferde liebte und den Wald. Der seinen Sport (Faustball) leidenschaftlich ausübte. Der sich für den Schützenverein und in der Nachbarschaft engagierte. Der anderen half, wann immer Hilfe benötigt wurde. Der gerne (und gut!) kochte und backte. Der Humor hatte, gerne lachte und auch sich selbst gerne auf die Schippe nahm. Der für jeden Spaß zu haben war. Dieser Vater, der wurde immer mehr von dem von innen heraus aufgefressen und ersetzt, durch dieses grauenvolle ETWAS, das ich als meinen versoffenen Erzeuger bezeichne.

Ich blickte zurück auf die letzten dreieinhalb Jahre. Auf die zunehmende Verrohung seiner Sprache. Auf seine zunehmende Primitivität in der Wortwahl. Auf seinen Rassismus und Sexismus. Auf seine Paranoia und seinen immer stärker werdenden Kontrollwahn.
Auf diese gedrückte Atmosphäre in meiner Familie. Verursacht durch die Unberechenbarkeit in seinen Stimmungen. Erst mein Vater, der mir in gelöster Stimmung im Garten zeigte, worauf es beim Anbau von Erbsen und Bohnen ankam. Dann am Abendbrottisch der versoffene Erzeuger, der jeden, der auf der Straße lang ging als Penner oder Flittchen titulierte, meine Geschwister verhörte und sich darüber ausließ, wie inkompetent seine Kollegen seien.
Und ich sah auf all die Lügen, die ihm inzwischen so federleicht von der Zunge flogen und bei denen die Zuhörerinnen und Zuhörer so oft vorgaben, sie würden sie ihm glauben. Frei nach dem Motto „Du hast Recht und ich habe meine Ruh“. In unterschiedlichen Verkleidungsvarianten, versteht sich: „Lass ihn nur reden.“, „Das geht uns nichts an./ Da mische ich mich besser nicht ein. Das steht mir nicht zu, da etwas zu unternehmen.“, „So schlimm wird es schon nicht sein./ Wenn es schlimm wäre, hätte sicher schon jemand etwas gesagt oder gemacht.“, „Wir können da sowieso nichts tun./ Es ist eh egal. Es ist eben so.“, „Jeder hat halt sein Päckchen zu tragen.“.
Jede(r) von ihnen fand „gute Gründe“, um die eigene Feigheit zu rechtfertigen.
Da waren so viele, die wegsahen, die schwiegen, die sich ihren verdammten Frieden auf Kosten anderer erkauften. Auf Kosten meiner Familie. Und auf meine Kosten. Die ihm das Gefühl gaben, er hätte schon Recht mit seinem Misstrauen und seinen Verdächtigungen. Und so sein Verhalten sanktionierten und seinen Wahn unterstützten und immer weiter verstärkten.
Sie gaben ihm Recht. Nach der selbstrechtfertigenden Logik eines Säufers hieß diese Bestätigung für ihn, dass er damit auch Recht haben musste. Mit jedem Schweigen wuchs seine Überzeugung, dass sein paranoides Misstrauen zu Recht bestand. Und mit jedem Schweigen schwanden seine Zweifel daran.
Wer schweigt, stimmt zu.
Das ist eben nicht erst dann von Bedeutung,
wenn es um Rassismus und Nationalismus geht.
Eine Zwischenbemerkung dazu:
DAS ist einer der Gründe dafür, dass mich die Sätze „Nun lass es doch endlich mal gut sein“, „Nun muss es doch endlich mal genug sein“, „Nun muss aber doch endlich mal wieder Ruhe einkehren“, „Nun müssen wir aber mal die Vergangenheit ruhen lassen und nach vorne sehen“ auf die Palme bringen.
Es sind Sätze der Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid, dass ein anderer Mensch oder eine Gruppe von Menschen fühlt.
Es sind Sätze, die eine erneute Gewalttätigkeit gegenüber dem/ der/ den Überlebenden darstellen. Durch solche Sätze wird versucht, die Verantwortung für das Leid weg von der/ dem Leidverursachenden und hin zum/ zur/ zu den Leidenden zu verlagern. Und da Ungerechtigkeit mein ganz persönlicher Haupttrigger ist, regt mich solch ein feiges und gleichgültiges abtun von Leid doppelt und dreifach auf. Nun, das nur als kleiner Einwurf.
Ich hatte jedenfalls sehr klar vor Augen, was kommen würde.
Und fragte mich, wie ich meinen Vater überleben sollte.
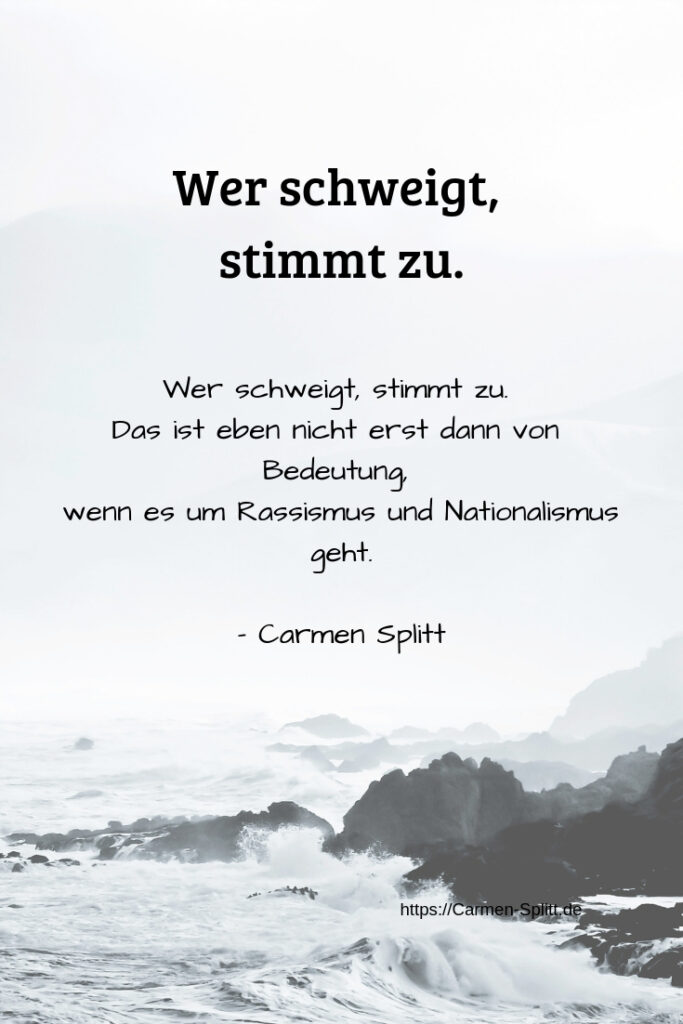
Die einzigen, die versuchten ihn vom Saufen abzuhalten, waren Oma und ich. Wir standen einer Übermacht der Gleichgültigkeit gegenüber. Ich hatte eingesehen, dass es unrealistisch war, darauf zu hoffen, dass wir in unserem Kampf jemals Unterstützung bekommen würden. Seine Vorgesetzten und Kollegen bei der Autobahnpolizei deckten ihn. Sie ignorierten meine Appelle, sahen mich als „Nestbeschmutzerin“ an und unterstützten ihn. Unserem Hausarzt war es – nach eigener Aussage – nicht möglich, ihn für einen Entzug zwangseinzuweisen. Die Nachbarn sprachen nur hinter seinem Rücken über die Sucht meines Vaters. Die Tankstellen, Tabakläden und Supermärkte verdienten gut an ihm. Mutter nahm seine Sauferei hin. Meinen Adoptivgeschwister verarschten ihn, wenn es möglich war und ansonsten ertrugen sie halt seine Paranoia. Aber gegen seine Sauferei, gegen die versuchte keiner etwas zu unternehmen.
Warum auch. Wieso hätte es sie auch interessieren sollen, dass mein liebender Vater von innen von einem Monster zerfressen wurde, das Stück für Stück seinen Geist und seinen Körper übernahm. Dazu hätte ihnen mein Vater als Mensch etwas bedeuten müssen. Was offensichtlich nicht zutraf. Wozu also die Mühe machen, wenigstens zu versuchen, etwas zu unternehmen.
Mitten im Raum stand ein unübersehbares riesiges, vor Wut brüllendes Ungetüm. Auf das zusätzlich rot-grün blinkende grelle Neonpfeile zeigten.
Jede(r) von ihnen hätte es zur Kenntnis nehmen, es zur Seite nehmen und sich darum kümmern können. Sie zogen es vor, es „zu übersehen“ und so zu tun, als gäbe es dieses Ding nicht. Es war für sie nicht weiter von Bedeutung. Sie lebten ihr Leben weiter. Um das Ungetüm herum. So als sei nie etwas gewesen.
Es würde nicht besser werden. Es würde nur noch schlimmer werden. Mein Vater würde sich Monat für Monat und Jahr um Jahr immer mehr seiner Gehirnzellen weg saufen. So lange bis gar nichts mehr von meinem Vater übrig sein würde. Es würde ein langsamer Tod sein, den mein Vater sterben würde. Er würde sich über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hinziehen. Und dieses langsame Sterben würde unendliches Leid mit sich bringen. Für meinen Vater – der in „guten Momenten“ Scham empfand für das, was aus ihm wurde. Für meine Adoptivgeschwister und unsere Mutter. Für Oma und für mich. So unendlich viel Leid.
Das einzige, was ich für meinen Vater noch tun konnte, war ihn zu töten. Jetzt. So lange noch etwas von ihm übrig war. So lange er sich noch selbst wiedererkennen konnte. Ihm im Tod etwas von der verloren gegangenen Würde zurückgeben. Das war das einzige, was ich tun konnte, um das Wachstum dieses Monsters in ihm zu stoppen. Für ihn, für meine Familie, für mich selbst. Ja, auch für mich selbst.
Ich wollte nicht rein altruistisch handeln. Ich machte mir nichts vor. Redete mir nicht ein, ich würde heldenhaft handeln. Hier ging es auch um eine gehörige Portion Egoismus. Er musste auch wegen mir sterben. Für meine eigene Gesundheit, mein eigenes (seelisches und körperliches) Überleben. Er oder ich. Und ich stellte mein eigenes Überleben über das seine. Er tat das seinerseits seit Jahren. Nun entschied ich, es ihm gleich zu tun.
Zwei oder drei Schüsse mit seiner Dienstwaffe wäre der sauberste Weg. Relativ schmerzfrei für ihn und sicher im gewünschten Ergebnis mündend. Und schließlich wusste ich, wie ich mit Schusswaffen umzugehen hatte. Aber er hatte seine Waffen immer gut versteckt. Ich hätte suchen müssen. Die Gefahr bestand, dass ich ihn wecken würde.
Ihn mit einem Kissen zu ersticken war nicht möglich. Ich hätte nicht die erforderliche Kraft gehabt. Er würde mich wegschleudern und ich bekäme keine zweite Chance.
Tabletten? Das wäre eine Möglichkeit, aber zu unsicher. Gift? Hätte ich erst aus den entsprechenden Pflanzen gewinnen müssen und in der Zwischenzeit Ausreden gefunden, es nicht zu tun. Rohrreiniger oder Rattengift in den Schnaps? Eine Möglichkeit, aber erstens zu grausam und zweitens zu unsicher im Ergebnis.
Also ein Messer. Ja, das war machbar. Ich ging in die Küche. Es musste gut in der Hand liegen, scharf sein, relativ schmal, damit ich es ihm durch die Rippen ins Herz stoßen und einmal umdrehen konnte. Und es sollte mit Sägeschliff versehen sein, für einen möglichst großen Gewebeschaden, falls ich das Herz verfehlen und er noch Gelegenheit haben sollte, sich das Messer im Reflex aus dem Körper herauszuziehen. Auf die Kehle zu zielen, barg zu viele Risiken.
Ich fand das Gesuchte, ging zurück, zog vorsichtig die Bettdecke zur Seite, um besser zielen und treffen zu können. Zu mehr als zu einem Stich würde ich wahrscheinlich nicht die Gelegenheit erhalten. Der erste Stich musste also sitzen.
Der Tod eines Menschen ist etwas Schwerwiegendes
Er ist nicht unumkehrbar. Mir war klar, dass wir alle eines Tages von den Toten auferstehen. Dennoch hat die Tötung eines Lebewesens (und somit auch die Tötung eines Menschen) etwas „vorläufig endgültiges“.
Es lag also in meiner Verantwortung, mir meiner selbst und meinen Motiven absolut sicher zu sein. Und selbstverständlich die Konsequenzen für alle Beteiligten zu bedenken und hierfür ebenfalls die Verantwortung zu übernehmen und zu tragen. Das war Teil meiner Verantwortung. Das was meine Pflicht.
Also nahm ich unter die Lupe, welche Motivation bei mir vorlag.
Da war die Situation innerhalb meiner
Familie. Versuchte ich meine Mutter zu „befreien“, damit sie sich eventuell
auch mir gegenüber wie eine Mutter verhalten würde? Ging es mir um ihre
Anerkennung? Nein und Nein. Sie war erwachsen, es war nicht meine Aufgabe, für
sie zu sorgen. Sie konnte sich jederzeit dazu entscheiden, das selbst zu tun.
Und sie würde das, was ich tun würde, auch nicht anerkennen. Wahrscheinlich
würde sie mich nur noch mehr ablehnen, als sie es sowieso tat. Würde es ihr mit
der Zeit besser gehen? Möglicherweise, doch sicher war dies nicht.
Würde der Tod meines Vaters irgend etwas anderes innerhalb meiner Familie
kitten? Wohl kaum.
Es ging vor allem um zwei Dinge. Ich wollte, dass mein Vater wenigstens noch
mit etwas Würde starb, bevor er sich endgültig in eine Bestie verwandeln würde.
Und ich wollte meinen Vater überleben.
Ich würde nie sicher wissen, ob der Tod ihm wirklich willkommen war oder ich mir das nur einreden würde, um mein Tun zu rechtfertigen. Damit zu Leben war erforderlich und machbar.
Die entscheidende Frage war jedoch, ob ich in der Tat das Recht hatte, mein eigenes Leben über das eines anderen zu stellen. Durfte ich diesen Egoismus an den Tag legen?
War mein Leben mehr wert, als seines? Ich kannte literarische Beispiele, in denen Eltern (und sogar Fremde) ihr Leben opferten, um Kinder zu retten. Auch Tiere opferten sich im Falle eines Falles für ihren Nachwuchs/ jüngere Herdenmitglieder. Es war ein Urinstinkt, mit der Mutter Natur den Fortbestand einer Art sicherte. Doch mein Überleben wäre nicht entscheidend für das Überleben der Menschheit. Und mein Vater würde sein Leben nicht freiwillig hergeben. Keins der beiden Argumente war hier gültig.
War mein Leben weniger wert? Ich hatte noch keine größeren Beiträge für die Gesellschaft geleistet. Aber das musste ich auch nicht, um etwas wert zu sein. Der Wert eines Menschen(leben) war ein Wert an sich, unabhängig von erbrachten Leistungen.
Ich war nicht mehr und auch nicht weniger wert, als mein Vater. Denn jeder Mensch war gleich viel wert. Jedes Leben war gleich viel wert.
Die Schlussfolgerungen lagen auf der Hand. Ein anderes Leben zu beenden kam nur in Frage, wenn das eigene Leben akut in Gefahr war oder dadurch zukünftige Gefahren für mich und/ oder andere abgewendet werden können, die so gravierend waren, dass sie die Beendigung eines Lebens rechtfertigen.
Angemessene Gewalt
Mein Leben war nicht akut in Lebensgefahr. Mein Vater lag schlafend und wehrlos vor mir.
Blieben die zukünftigen Gefahren. Dieses Argument traf zu.
Mein Vater würde immer weiter saufen. Er würde sich charakterlich immer weiter verändern. Seine Paranoia, seine Kontrollwut und seine Gehässigkeit würden weiter wachsen. Er war jetzt schon unberechenbar. Seinem Terror konnte keiner von uns entgehen. Es gab keine Regeln, denen wir folgen konnten (so obskur sie auch sein mochten), um „auf der sicheren Seite zu sein“ und in Frieden gelassen zu werden. Egal, was wir sagten oder taten – er verdrehte die Tatsachen so lange, bis sie in sein zunehmend paranoides Bild von den Dingen passten. Jahr um Jahr würde es immer schlimmer werden. Irgend wann, würde sein Wahn Menschenleben kosten.
Mit meiner Mutter ging es bereits jetzt gesundheitlich rapide bergab. Ihre Nesselsucht, ständigen Kopfschmerzen und Magengeschwüre kamen nicht aus dem Nichts.
Und eines Tages würde mein Vater den Rest seines Anstands verlieren, die letzten Hemmungen fallen lassen und seine wachsende Frustration und Wut mit den Fäusten oder mit der Waffe an anderen auslassen. Entweder an einem Fremden. Oder an einem Familienmitglied.
Das war absehbar. Aber war es unabänderlich?
Rechtfertigten mögliche zukünftige Ereignisse, dass ich ihn jetzt zum
Tode verurteilte? Bevor dies geschehen war? Als Präventionsmaßnahme?
Anklage, Verurteilung und Bestrafung, noch vor der Tat – konnte das richtig
sein?
Oma und ich spielten oft das Spiel „Was wäre wenn?“. Was wäre, wenn Napoleon
Sieger geblieben wäre und Deutschland zu Frankreich gehöre? Was wäre, wenn
Flugzeuge nie erfunden worden wären? Was wäre, wenn wir in der Zeit reisen und
Massenmörder wie Hitler und Stalin töten könnten, bevor das große Morden
beginnt?
Unabhängig voneinander kamen wir beim letztgenannten Beispiel zu der Erkenntnis, dass ein Unrecht nicht durch ein anderes Unrecht zu rechtfertigen ist. Auch mit dem Wissen der Zukunft dürfen wir einen Verbrecher/ eine Verbrecherin nicht für etwas verurteilen oder gar bestrafen, was er oder sie noch gar nicht getan hat. Schon gar nicht mit dem körperlichen oder seelischen Tod, den wir als Menschen verursachen, jedoch nicht ungeschehen machen können.
Wir dürfen kein Leid zufügen, nur um die Möglichkeit eines zukünftigen anderen Leids auszuschließen.
Was für Hitler und Stalin galt, hatte (unbequemerweise) natürlich auch bei meinem Vater Bestand. Ich durfte ihn nicht töten, ihm kein Leid zufügen, „nur“, um zukünftiges anderes Leid – sei es für mich oder Dritte – auszuschließen.
Erkenntnis oder Feigheit?
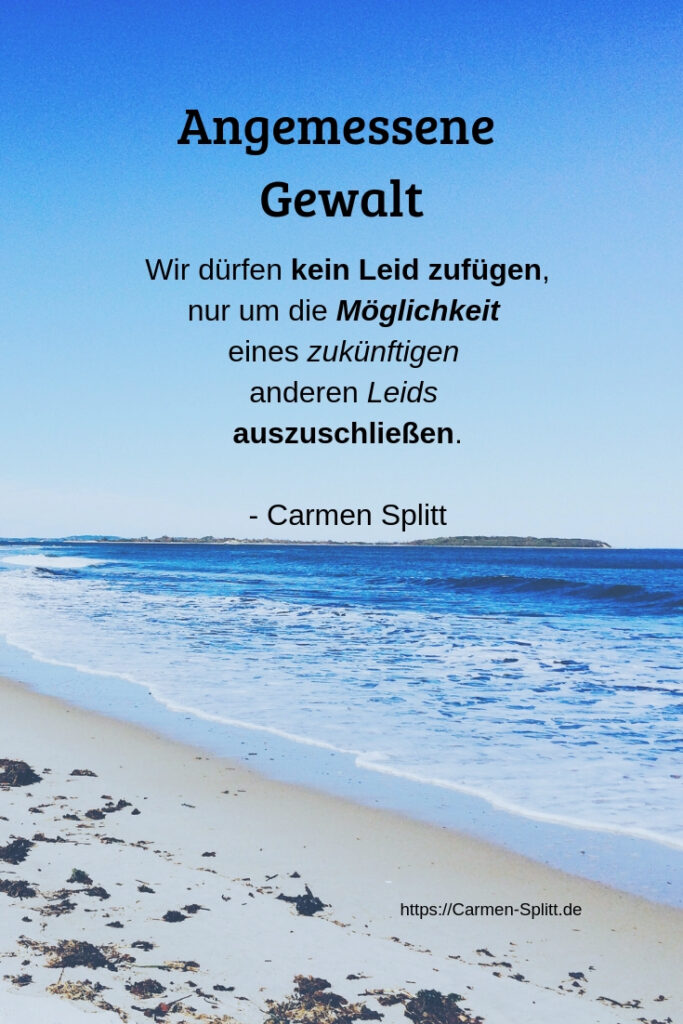
Ich entschied mich also, an diesem Tag meinen Vater überleben zu lassen.
Doch war ich mich selbst gegenüber ehrlich, was meine Motive anging? Ließ ich meinen Vater überleben, weil die Argumente die dafür sprachen, mich überzeugt hatten? Oder ließ ich meinen Vater überleben, weil ich eventuell die Konsequenzen fürchtete, die damit einher gehen würden, wenn ich ihn töten würde? Würde ich meinen Vater überleben lassen, weil ich zu feige war, um zu tun, was getan werden musste? Oder würde ich meinen Vater überleben lassen, weil es richtig wäre?
Auch in diesem Punkt musste ich mir meiner Motive und meiner selbst absolut sicher sein. Um welche Konsequenzen ging es also. Wie würden sie aussehen?
Man würde mich vor Gericht stellen und wegen Mordes verurteilen. Aufgrund meines Alter würde ich wohl nach Jugendstrafrecht verurteilt werden und mit etwas Glück mit 18 Jahren das Gefängnis wieder verlassen können. 10 Jahre Gefängnis waren keine rosigen Zukunftsaussichten. Aber ich würde sie überstehen. Meine beruflichen und gesellschaftlichen Möglichkeiten wären im Anschluss an den Mord, die Verurteilung und den Gefängnisaufenthalt stark eingeschränkt. Vorsichtig ausgedrückt. Aber auch das würde ich überstehen.
Unsere Mutter wäre entsetzt und würde mich ablehnen. Ihr Verhalten mir gegenüber würde sich also nicht groß ändern.
Die Nachbarschaft hätte etwas Neues, über das sie tratschen könnte. Bitte sehr. Was Leute über mich zu sagen hatten, denen es gleichgültig war, ob es mir gut geht oder ich am krepieren bin, ging mir am Arsch vorbei.
Wildfremde, die nicht das Geringste über mich und meine Lebenssituation wüssten, würden mich in Abwesenheit – und ohne mir die Möglichkeit der Verteidigung zu geben – anklagen und verurteilen. Auch nichts Neues für mich.
Ich würde gegen Gottes Gebot „Du sollst nicht töten“ verstoßen. Gott kann ja einen Mord nach dem anderen befehlen oder untätig geschehen lassen, uns Menschen gesteht ER das allerdings nicht zu. Also würde ER mich in der Hölle braten lassen wollen. Tja, da Gott alles weiß, wusste er auch, was mich erwarten würde. Ich hatte um all diesen Scheiß nicht gebeten. ER hatte trotzdem entschieden, dass ich all dies erleben musste. Also hatte ich einige gute Argumente, um mit IHM über die Höhe meines Strafmaßes zu diskutieren.
Am schlimmsten wäre für mich die Enttäuschung, die ich in Omas Augen sehen würde. Die Enttäuschung darüber, dass ich Gewalt anwenden würde, ohne mich oder andere gegen unmittelbare Gewalt wehren zu müssen. Ich würde ihre Enttäuschung über meine Entscheidung und ihre Trauer um mich und über das, was diese Entscheidung aus mir machen würde, aushalten müssen. Ihren Schmerz zu sehen, würde mir das Herz brechen. Es würde mir enorm weh tun, diesen Schmerz verursacht zu haben. Aber weitaus sicherer als das Amen in der Kirche war für mich, dass meine Oma mich liebte. Sie würde mich auch weiter lieben, ohne wenn und aber. Um meiner selbst willen. Ich würde also auch das überstehen.
Ja, ich war mir nun sicher. Ich würde meinen Vater überleben lassen, nicht weil ich zu feige wäre, das zu tun, was getan werden musste. Sondern ich würde meinen Vater überleben lassen, weil es das richtige war. Leider.
Ich musste meinen Vater überleben lassen. Leider. Doch wie konnte ich meinen Vater überleben?
Ausklang: Wie ich meinen Vater überleben konnte.
Ich hatte mich entschieden. Also deckte ich meinen Vater wieder zu, brachte das Messer zurück in die Küchenschublade, kochte mir eine Tasse Tee und ging in mein Zimmer.
Wie konnte ich meinen Vater überleben? Ganz klar, ich musste eine Überlebensstrategie festlegen.
Als erstes legte ich fest, dass meine Entscheidung, meinen Vater überleben zu lassen, nur bis auf Weiteres Bestand haben würde. Seine psychische Gewalttätigkeit würde nicht zu seinem Tod durch mich führen. Sollte er jedoch körperliche Gewalt gegen meine Oma ausüben oder gegen mich, dann würde ich ihn töten. Und nichts und niemand würde mich davon abhalten. Außerdem würde ich an jedem Neujahrsmorgen das vergangene Jahr Revue passieren lassen und prüfen, ob sich bei der Waagschale der Argumentation, für und gegen die Ermordung meines Vaters, für mich etwas Neues ergeben würde, das ich ebenfalls zu berücksichtigen hätte.
Das zweite war, dass meine Bevor-Kiste-Liste eine noch größere Bedeutung bekommen würde. Ich würde noch intensiver leben. Noch bewusster im Moment leben. Ich würde in dieser Hölle das Leben genießen, so gut ich konnte.
Als Drittes entschied ich: Ich würde dahin fliehen, wo mich seine Gehässigkeit, seine Paranoia, sein Terror nicht erreichen konnten. Ich würde mich in die Welt der Bücher flüchten, der Musik, des Theaters, des Films und in die Geborgenheit der Natur.
Viertens würde ich nicht aufgeben. Ich würde nicht nachgeben. Ich würde mir nicht einreden lassen, ich hätte es nicht besser verdient. Noch weniger würde ich mir einreden lassen, ich würde selbst schuld sein am Verhalten meines Vaters. Ich würde mir keine Schuldgefühle einreden lassen. Ich würde mir auch nicht einreden lassen, Verständnis für die Feigheit der Menschen um mich herum aufbringen zu müssen. Und ich würde mich verdammt noch einmal nicht verstecken. Denn ich hatte nichts falsch gemacht. Ich würde der Paranoia meines versoffenen Erzeugers nicht nachgeben und mich nicht auch noch zu seiner Beruhigung so verhalten, als wäre er mit seinen Anschuldigungen im Recht.
Ich würde mich nicht brechen lassen.
Niemals!
Ich würde meinen Vater überleben. Ich würde eine Überlebende sein!
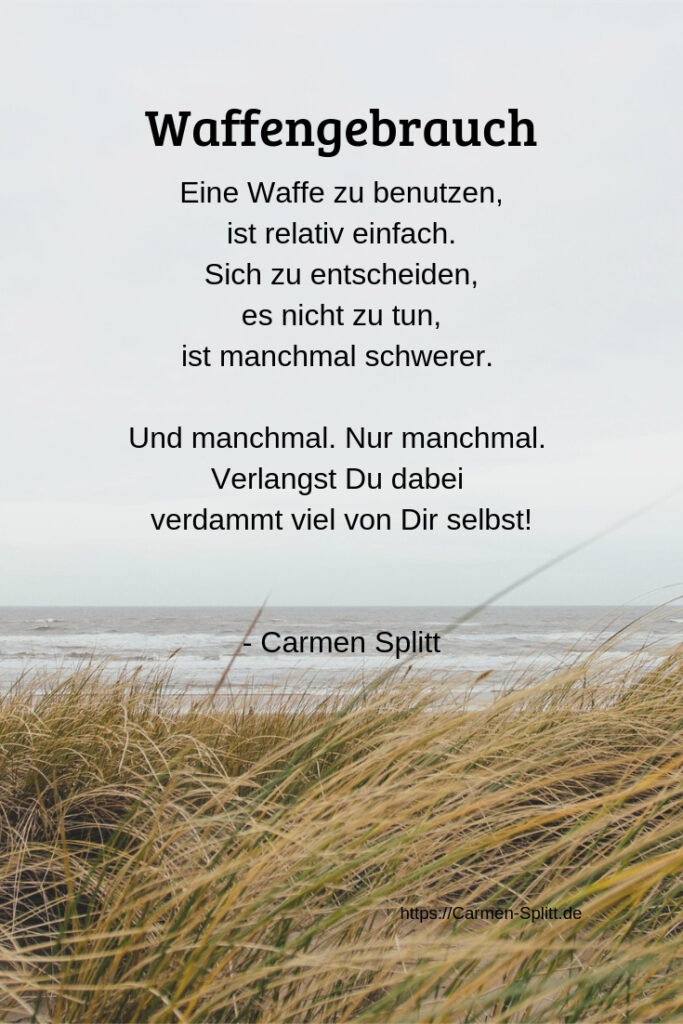
Nachdem ich meine Überlebensstrategie festgelegt hatte und noch ein letztes Mal alle Argumente durchspielte, erlaubte ich mir zu weinen.
Ich weinte, weil mich die Feigheit meiner
Umgebung vor eine Wahl gestellt hatte, die kein Kind treffen sollen müsste. Ich
weinte um meinen Vater, denn ich konnte ihn nicht retten. Nicht einmal den Rest
seiner Würde. Ich weinte, denn meine Erinnerungen waren alles, was meinen Vater
überleben lassen würde, den Vater meiner frühen Kindheit, nicht dieses Etwas,
das ihn auslöschen und ersetzen würde.
Ich weinte, weil ich allein war. Der einzige Mensch, der mich liebte und verstand,
war meine Oma. Und sie würde vor mir sterben.
Dann wäre ich noch einsamer. Dann hätte ich niemanden mehr.
Ich weinte um meine Kindheit und ich weinte um meine Zukunft.
Meine Oma spürte, das etwas nicht stimmte und fand mich weinend auf meinem Bett. Sie fragte mich besorgt, was los sei. Ich sagte ihr nur, dass ich erkannt hatte, dass sie eines Tages sterben würde und ich dann ganz allein zurück bleiben würde. Sie hielt mich fest, tröstete mich und versprach mir, so lange wie möglich für mich da zu sein. Von der Entscheidung, die ich an diesem Tag traf, erzählte ich ihr nie. Ich habe nie jemandem etwas davon erzählt. Bis zum heutigen Tag nicht. Jetzt aber, ist die Zeit dafür reif.
Ich war 8 Jahre alt und an diesem Tag endete meine Kindheit endgültig.
Ich hatte mich entschieden, meine Vater überleben zu lassen.
Ich hatte mich für ein Leben in der Hölle entschieden.
Von dem Moment, als ich durch die Terrassentür das Haus betrat, bis zu dem Augenblick, als meine Oma mich fand, waren gut 40 Minuten vergangen. 40 Minuten, in denen sich für mich meine Zukunft entschied. 40 Minuten, in denen sich entschied, was für ein Mensch ich sein und nach welchen Werten ich leben wollte. 40 Minuten, in denen mir klar wurde, dass ich anders als andere Kinder war, selbst anders, als die meisten Erwachsenen. Meine Art zu denken war analytischer und es war umfassender/ tabuloser und zeitunabhängiger, als es bei den meisten anderen Menschen der Fall war. (Ich habe in meinem Leben nur drei Personen kennengelernt, bei denen ich mir keinen geistigen Maulkorb umlegen musste, um nicht für Irritationen zu sorgen und als arrogant eingestuft zu werden: Meine Oma, Herr Prof. Dr. Iseringhausen und – zeitweise – Herr Pastor Florian Schwarz.)
Die Irrtümer, denen ich unterlag
Als ich entschied, meinen Vater überleben zu lassen, ging ich von bestimmten Dingen aus.
Mann, hatte ich mich geirrt.
Ich hatte Gottes beschissenen Sinn für Humor nicht eingerechnet.
- Unsere Mutter starb 1984 an den Folgen einer „Routine-OP“ eines Magengeschwürs.
- Die nächste Frau meines versoffenen Erzeugers zog kurz danach ein. Jemand der völliges Verständnis hatte – für ihn, seine Sauferei (sie becherte fröhlich mit) und seine Paranoia (sie überboten sich darin gegenseitig).
- Nachdem meine Adoptivgeschwister sich verpisst hatten und Oma und mich allein in der Scheiße zurückließen, musste ich feststellen, dass Paranoia, die sich auf vier Personen bezieht anders anfühlt als Paranoia, die sich im Anschluss auf nur noch zwei Personen konzentriert. Schlimmer geht immer.
- Mein versoffener Erzeuger betrog mich um das Erbe meiner Mutter.
- Zusätzlich stahl er meine Halbwaisenrente, Bargeld aus dem Portemonnaie und die Beträge aus den von meiner Mutter für mich abgeschlossenen Verträgen für Ausbildungsabsicherung und Bausparen.
- Als ich 16 Jahre alt war, wollte ich meinem Vater das Sorgerecht entziehen lassen und auf meine Oma übertragen lassen. Wir fuhren mit dem Bus nach Walsrode, zum Jugendamt. Der Beamte sagte, die Chancen auf Erfolg stünden schlecht, mein Erzeuger sei ein allseits respektierter Mann. Ich müsse bis zur Volljährigkeit außerdem in ein Heim. Das wollte Oma nicht zulassen. Wir baten um Stillschweigen und fuhren „nach Hause“. Mein versoffener Erzeuger war bei unserer Rückkehr bestens informiert. Er konnte das Gespräch fast wortwörtlich wiedergeben. Einige Tage später hatte ich eine Rasierklinge am Handgelenk. Doch ich schwor mir damals stattdessen, ihn nicht gewinnen zu lassen, sondern stattdessen noch auf seinem Grab zu tanzen und dabei einen Piccolo zu trinken.
- Ich hatte unterschätzt, das Alkohol konserviert. Der Körper meines Vaters starb leider erst 2002. (Ich erfüllte übrigens meinen Schwur. Nichts hat mir je so gut getan!)
- Nach seinem Tod ließ mein versoffener Erzeuger mir von seiner Witwe – im Zuge der Mitteilung seines Todes – zusätzlich ausrichten „Wie enttäuscht er von mir sei. Wie enttäuscht darüber, dass ich mich nicht mehr um ihn gekümmert hätte.“ (Ziemlich ironisch, angesichts der Tatsache, dass er sich um mich seinerseits nie gekümmert hatte. War ich krank, bestand seine Reaktion stets aus der Frage „Was hat sie denn jetzt schon wieder?“. Noch ironischer, wenn man bedenkt, dass – trotz meiner Verachtung für das, was aus ihm geworden war – ich diejenige gewesen bin, die ihn durch eine kleine „Verschwörung“ mit unserem damaligen Hausarzt dazu brachte, denselben endlich aufzusuchen, statt gegen sein Sodbrennen Unmengen von Knoblauchpillen zu schlucken.“
- Selbst aus dem Grab heraus, hat er mir noch einen verpasst. Er lag noch nicht einmal unter der Erde, da überreichte seine Witwe uns (meiner Oma und mir) die Kündigung für die Wohnung. Es sei jetzt ihr Haus und sie wolle es ohne uns. Das Testament, das mir zeitnah vom Anwalt zugespielt wurde, bestätigte dies. Berliner Testament. Meine Adoptivgeschwister klagten auf ihren Pflichtanteil. Ich verzichtete darauf. Zwar hatte mein versoffener Erzeuger seine Gier nach meinem Geld immer wieder damit begründet, dass ich dieses Haus eines Tages erben würde, doch mir war immer klar, dass dies nur eine Ausrede war. Ich hätte wenigstens mein Pflichtteil am Erbe einklagen können. Ich hätte auch gegen die Kündigung der Wohnung wegen Eigenbedarf klagen können (denn das Haus wurde von der „trauernden Witwe“ flugs verkauft). Aber all das war mir die Mühe nicht wert. Er war tot. Möge er in der Hölle verrotten. Und seine Witwe? Wer nichts aus eigener Kraft erschafft, dem bleibt eben nichts anderes übrig, als auf Kosten anderer zu leben. Sie würde auch eines Tages sterben.
Was ich am meisten unterschätzt habe, ist die Tatsache, dass andere Menschen mich nicht so akzeptieren würden, wie ich bin. Sie verstehen nicht, wenn ich anders reagiere, als sie es erwarten. Sie können mein Verhalten oft nicht einordnen. Und dadurch macht ihnen mein „abnormes“ Verhalten manchmal Angst. Meine Direktheit, meine Offenheit, meine Ehrlichkeit und auch meine Schnelligkeit irritieren sie. Ebenso meine Art, mich zu stellen und auszuhalten, durchzuhalten, durchzustehen.
Ich weiß, dass mein Verhalten für andere zeitweise nicht nachzuvollziehen ist. Aus diesem Grunde bitte ich darum, mich zu fragen, wenn etwas von dem, was ich sage oder tue, nicht verstanden wird. Nur, wird diese Bitte in der Regel leider ignoriert. Das wiederum ist etwas, dass ich meinerseits nicht verstehen kann. Wie kann man über etwas, das man nicht versteht, nicht mehr in Erfahrung bringen wollen? Wie kann man sich dem nachdenken verweigern?
Mir wurde unter anderem der – wohlgemeinte! und auch so angenommene – Ratschlag gegeben, nicht immer so viel nachzudenken. Ich wünschte, ich könnte das nur ein einziges Mal tun. Mir das Leben so leicht zu machen. Etwas nicht nachvollziehen zu wollen. Aber ich kann mir nicht einmal vorstellen wie das ist, nicht zu denken. Wenn ich wach bin, denke ich. Permanent. Ohne Pause. Ich denke darüber nach, „was wäre wenn …“, über alltägliche Dinge, über philosophische Fragen, über Gott und die Welt, über Gedichte, über Liedtexte, über Gemälde und die Absicht des Künstlers, über Romane und ihre verschiedenen Ebenen, … – ich denke und denke und denke. Wie kann man aufhören zu denken?
Es gibt für mich keine Grenzen im Denken. Und ich spreche aus, was ich denke und was ich fühle. Für mich besteht allerdings ein immenser Unterschied zwischen
- vorstellen, erträumen, darüber sprechen,
- zu etwas physisch und psychisch in der Lage zu sein,
- dazu bereit zu sein, etwas zu tun,
- dazu berechtigt zu sein, etwas zu tun,
- etwas auszuführen.
Für andere scheint es da keinen Unterschied zu geben.
Ich ordne vieles von meinem Verhalten ursächlich dem zu, was ich als Kind erlebt habe, was ich trotz meinem versoffenen Erzeuger und meiner gleichgültigen Umgebung überlebt habe. Aber das nicht. Denken, Analyse, Differenzierung, Selbstregulierung und Selbstbeherrschung liegen einfach in meiner Natur.
Wer mehr über das Thema „Väter“ nachdenken möchte, dem empfehle ich den Kulturgottesdienst „Papa?“ von Kulturgottesdienste.de. Herr Pastor Florian Schwarz hat sicherlich eine andere Sicht auf das Thema Väter, als ich sie habe.
Wer ihn einmal mit seinem eigenen Vater zusammen gesehen hat, oder Florian Schwarz zusammen mit seinen Töchtern erlebt hat, der weiß, wie viel Liebe und Achtung es auch zwischen Vätern und ihren Kindern geben kann. (Mir hat es geholfen, das bei ihm sehen zu dürfen. Es hat mir bestätigt, dass ich als Kind keiner Utopie hinterher lief, sondern dass Liebe und Achtung zwischen Vätern und Kindern real existieren kann. Es hat mir bestätigt, dass mein Wunsch, dies selbst erleben zu dürfen, weder unverschämt noch abnorm war. Das hat mir in gewisser Hinsicht Trost gespendet.) Wer es zeitlich nicht zum Gottesdienst schafft, der kann im nachhinein die Predigt wenigstens in Textform nachlesen. Herr Pastor Schwarz veröffentlicht sie in der Regel zeitnah nach den Kulturgottesdiensten. Ich wünschte nur, er würde dies auch mit seinen anderen Predigten tun.
Ich hatte zwei Väter. Den Vater meiner frühesten Kindheit, den ich durch meine Erinnerungen weiter überleben lasse und einen versoffenen Erzeuger, der mich terrorisierte und brechen wollte. Beide befanden sich in ein und dem selben menschlichen Körper. Wie ist das bei Dir? Welches Verhältnis hast Du zum Thema „Vater“? Hinterlasse mir gerne einen Kommentar. Deine Meinung interessiert mich.
